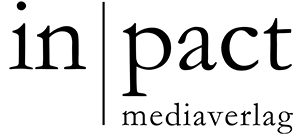Als sogenannte Smart City gilt eine Stadt, die durch die intelligente Nutzung von Daten lebenswerter wird. Wie das konkret aussehen kann, sieht man zum Beispiel in Hamburg, Spitzenreiter des aktuellen Smart City Index 2020, einem Digitalranking deutscher Großstädte, 2019 zum ersten Mal zusammengestellt vom Digitalverband Bitkom. Gemessen wird, wie gut die Bereiche Verwaltung, Energie und Umwelt, IT und Kommunikation, Mobilität und Gesellschaft in verschiedenen intelligenten Städten ausgebaut und digitalisiert sind.
Hamburgs Stärke sind Innovationen im Bereich Mobilität: Hier gleiten zum Beispiel elektrisch betriebene Moia-Busse durch die Stadt und bringen Passagiere zu virtuellen Haltestellen. In der neuen Mobilitäts-App Switch ist es möglich, mit wenigen Klicks ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch für Moia und bald ebenso für Bike-Sharing und Leihautos zu kaufen. Auch für viele andere Services, von Corona-Warnmeldungen über Stadtverwaltungsangelegenheiten bis hin zu Abstimmungen über die Qualität von Parks, geht Hamburg online.
Recht auf Stadt
Eine gut funktionierende Smart City sollte die verschiedenen Bereiche miteinander kombinieren, um ihren Bewohnern auf Basis der Daten und ihrer Auswertung ein besseres Leben anzubieten. Dabei geht es nicht nur um vereinzelte Maßnahmen wie ein gratis WiFi oder automatisch gesteuerte Ampelschaltungen, sondern auch und vor allem darum, mit der ganzen Gesellschaft eine attraktivere Stadt zu schaffen. Experten sprechen von einem „Recht auf Stadt“, das Bürger*innen mithilfe von Daten geltend machen können.
Aus gesellschaftlicher Sicht ist das Recht auf Stadt eines der größten Vorteile der Smart City. Dieser Begriff, der im Jahr 1968 vom französischen Philosophen Henri Lefebvre eingeführt wurde, besagt, dass wir als Stadtbewohner alle das Recht haben sollten, in der Stadt zu wohnen, zu arbeiten und zu spielen. Mit dem Begriff „spielen“ ist ein kreatives Schaffen gemeint, also die Möglichkeit, die Stadt zu gestalten.
Partizipative Ansätze in der ganzen Welt haben oft das Problem, das sie nicht inklusiv genug sind. Die Hoffnung für Smart Cities besteht darin, dank des allgemein zugänglichen Internets und der verwandten Technologien wie Low Range Wide Area Networks und Funknetzwerken zukünftig deutlich mehr Personen das Recht zu geben, die Stadt zu gestalten. Sei es durch Kooperation in der Stadtplanung, durch Meinungsbilder, durch vereinfachten Kontakt zur Verwaltung, durch das Melden von Verschmutzungen oder durch Abstimmungen zur Gestaltung des Stadtbilds, die Digitalisierung soll dabei helfen, eine Stadt zu kreieren, die den Bedürfnissen vieler statt denen einiger weniger entspricht.
Anders als bei Bereichen wie Mobilität oder digitale Verwaltung lässt sich gerade dieser gesellschaftliche Aspekt der Smart City nicht ohne Weiteres messen. Gleichzeitig handelt es sich um die wohl größte Chance des Vorhabens. Denn wenn die Gesellschaft die Neuerungen nicht akzeptiert oder nicht daran teilhaben kann, werden Smart Cities keinen Erfolg haben.
Das leitende Prinzip darin, die Smart City lebenswerter und zugänglicher zu machen, ist als „Discovery statt Design“ bekannt. Mithilfe der Schwarmintelligenz sollen neue Optionen der Stadtentwicklung erkundet werden. Digitale Tools sind dabei das Mittel zum Zweck. Idealerweise kann künftig die ganze Stadtbevölkerung dazu beitragen, ihre Stadt der Zukunft zu gestalten und kontinuierlich zu verbessern.
Doch noch hakt es bei den schlauen Städten in Deutschland: Sie sind oft nur in einigen Bereichen des Smart City Index vertreten, bei ihren Bewohner*innen nicht als intelligent anerkannt oder für Menschen, die weniger digitalaffin sind, kaum zugänglich. Noch steckt das Smart-City-Konzept in den Kinderschuhen und ist kein Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Allerdings liegt dies weniger an den Technologien selbst als vor allem an Rahmenbedingungen, unter denen sie genutzt werden.
Herausforderung Datenschutz
Ein Hindernis in Deutschland ist der starke Datenschutz. Denn die Smart City basiert auf einer umfangreichen Datensammlung. Dabei sind die Füllstände von Mülltonnen und die Luftqualität noch „unschuldig“, da es sich hier um anonymisierte Daten handelt. Für Aufschrei hingegen sorgen Technologien, die personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten, wie etwa Gesichtserkennung mittels Überwachungskameras. Diese soll dazu beitragen, Straftaten aufzuklären. Oder könnte dazu genutzt werden, sich statt eines Tickets im öffentlichen Nahverkehr auszuweisen. Die japanische Metropole Osaka testet ein solches System gerade an Mitarbeitern der U-Bahngesellschaft. Zur Weltausstellung 2025 plane man, die Technologie an allen 133 Bahnhöfen der Region einzuführen.
In Deutschland jedoch stehen Grund- und Personenrechte im Vordergrund. Die EU erwägt seit Anfang 2020 sogar, Gesichtserkennung ganz zu verbieten. Noch schwieriger wird es bei digitalen Partizipationsmöglichkeiten – also genau dort, wo das Recht auf Stadt zum Einsatz kommen könnte. Denn viele Menschen haben Angst davor, ihre Daten online zu teilen. Sie fürchten Hacker, Datenklau und die Veröffentlichung eventuell sensibler Daten. Kritisch zu sehen ist auch das Marketing vieler Unternehmen, das bereits jetzt sehr personalisiert ist. Wer künftig noch mehr Daten in der Smart City teilt, sei es durch einen Smart Meter für die Stromablesung, durch eine digitale Wahlmöglichkeit zum Spielplatz um die Ecke oder durch die Online-Bezahlung des neuen Personalausweises, könnte dadurch noch mehr Daten teilen, die dann für Werbung genutzt werden.
Neben der mangelnden Akzeptanz für das Teilen von Daten besteht in Deutschland auch das Problem einer „digital divide“, einer digitalen Kluft. Denn während manche Teile der Bevölkerung gar nicht mehr ohne ihr Smartphone auskommen, haben andere noch immer Probleme mit Online-Banking, Zoom-Treffen und anderen alltäglichen Technologien, die ein wichtiger Bestandteil der Smart City sind und dabei helfen können, das Recht auf Stadt umzusetzen. Selbst der positive Effekt auf die Digitalisierungsdynamik, den man der Corona-Pandemie inzwischen zuspricht, werde daran nichts ändern, wie eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Capgemini befindet.
Digitale Kluft
Die Smart City steht und fällt mit der Qualität der Daten. Sie kann also nur funktionieren, wenn möglichst viele ihrer Bewohner partizipieren und zumindest einige ihrer Daten teilen. Auf diese Weise kann eine Stadt entstehen, die lebenswert ist und einem signifikanten Teil der Bevölkerung gefällt. Mehr noch, die Interaktion mit Daten erlaubt es, das Recht auf Stadt wahrzunehmen und die eigene Smart City mitzugestalten.
Der Schlüssel für die Weiterentwicklung von Smart Cities in Deutschland ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Indem Daten intelligent genutzt und zugleich ausreichend geschützt werden, ist es möglich, die genannten Herausforderungen zu meistern. Durch eine Balance zwischen Datennutzung und Datenschutz wird die intelligente Stadt erst möglich. Zudem ist es nötig, mehr Ressourcen zur Überwindung der digitalen Kluft einzusetzen, um die Smart-City-Technologien möglichst vielen Personen zugänglich zu machen.
Für Inspiration sorgt ein Blick auf die weltweiten Vorreiter im Bereich Smart Cities: Singapur, Helsinki und Zürich führen das aktuelle internationale Smart-City-Ranking des Institute for Management Development (IMD) und der Singapore University of Technology and Design (SUTD) an. Bruno Lanvin, Präsident des IMD Smart City Observatory, fasst es so zusammen: „Städte, die Technologien, politische Führung und eine starke Kultur von ‚gemeinsam leben und agieren‘ umsetzen, stehen im Index vorn.“