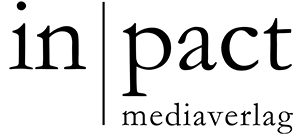Warum die Nachfolgerinnen und Nachfolger dennoch optimistisch in die Zukunft blicken, erklärt Sarna Röser, Bundesvorsitzende des Verbands „Die Jungen Unternehmer“ und designierte Unternehmenschefin.
Frau Röser, Sie vertreten die nächste Generation der mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer, mithin diejenigen, die als Rückgrat der deutschen Wirtschaft angesehen werden. Wie sind sie durch die Pandemie gekommen?
Es liegen zehrende 15 Monate hinter uns. Die Corona-Pandemie, die Schließungen und der Lockdown haben für viele Familienunternehmen eine Vollbremsung bei voller Fahrt bedeutet, etwa bei vielen Zulieferbetrieben, im Messebau, Hotellerie, Gastronomie. Viele Unternehmen haben ihre Eigenkapitalreserven aufgebraucht und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Dennoch sind wir alle grundsätzlich optimistisch. Die Unternehmer haben schnell reagiert, sie haben Hygienekonzepte umgesetzt, Arbeit ins Homeoffice verlagert und geschaut, dass sie ihre Geschäftsmodelle anpassen.
Die Pandemie als Innovationstreiber? Kann man das so sagen?
Zumindest sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer sehr innovativ, ja geradezu ‚Kreative Problemlöser‘ – wie ich es gern nenne – geworden. Die Krise war und ist eine Phase, in der wir alle schnell umdenken und handeln mussten.
Wie war das bei Ihnen? Sie sind ja selbst designierte Nachfolgerin in einem mittelständischen Familienunternehmen.
Wir sind mit unserem Unternehmen mit bald 100-jähriger Geschichte im Tiefbau tätig. Mein Vater leitet es in dritter Generation. Ich bin seine Nachfolgerin und werde in vierter Generation übernehmen. Bei uns stand zu Beginn der Pandemie die Frage im Raum, wie wir es schaffen, die Produktion aufrecht zu erhalten, weil wir unsere Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schicken konnten. Betonrohre lassen sich eben nicht vom Schreibtisch aus herstellen und verlegen. Wir haben aber den Großteil der Verwaltung ins Homeoffice geschickt. Es gab eine gewisse Eingewöhnungszeit, und das Thema Führung hat eine ganz neue Bedeutung bekommen: In Remote Leadership muss man sich erstmal einfinden. Aber es hat alles gut geklappt, zumal es in der Baubranche glücklicherweise relativ gut lief und auch die Infrastrukturprojekte weiter verfolgt wurden. Die Baustellen waren geöffnet, sodass wir durcharbeiten konnten.
Ist Ihre Grundeinstellung derzeit optimistisch oder schauen Sie eher skeptisch in die Zukunft?
Wir Jungen Unternehmer sind eigentlich grundsätzlich optimistisch und hoffen auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Dafür muss aber die Politik die richtigen Weichen für einen echten Wachstumspakt stellen. Wir Junge Unternehmer fordern von der Politik, den „Restart Deutschland“ gemeinsam anzupacken. Wir müssen Fesseln sprengen, Bürokratie abbauen und den Weg freimachen für die Unternehmen, dass sie wieder schnell auf den Wachstumspfad kommen und sich aus dieser Krise herausarbeiten können. Diesen Freiraum muss man den Familienunternehmen jetzt schaffen.
Grüne und SPD wollen eine Vermögenssteuer einführen und den Spitzensteuersatz anheben. Was würde das bewirken?
Was die Grünen und die SPD zum Beispiel mit einer Vermögensteuer vorhaben, würde wie eine Wachstumsbremse wirken. Und das wäre fatal. Sie schwächt Firmen und ihre Inhaber, verzehrt die Rücklagen und das Investitionskapital der Unternehmen. Sie sollen doch aber gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, am Standort Deutschland investieren, nicht zuletzt für mehr Klimaschutz und Digitalisierung. Da müssen sich die Grünen – wie alle anderen Befürworter auch – die Frage gefallen lassen, wie das gehen soll, wenn den Unternehmen das Geld entzogen wird?
Stattdessen?
Es braucht eine Unternehmenssteuerreform, die die Besteuerung einfacher und effizienter gestaltet. Vereinfachte Abschreibungsverfahren, Wegfall des Solidaritätsbeitrags, Reform der Thesaurierungsbesteuerung, Abschaffung der Hinzurechnungstatbestände in der Gewerbesteuer oder die Verkürzung von Aufbewahrungsfristen: So werden Bürokratiekosten eingespart, das Geld steht dann für Zukunftsinvestitionen bereit.
Die großen Dax-Konzerne, vor allem in der Automobilindustrie, haben durch ihre Marktmacht und die gut bezahlten Arbeitsplätze einen starken Einfluss auf das politische Geschehen. Ist der Mittelstand das Stiefkind der Politik?
Die meisten wissen um den Stellenwert des familiengeführten Mittelstandes und dass die Welt Deutschland um seine exportstarke und dezentrale Wirtschaftsstruktur beneidet. Bei aller Diskussion um nationale Industriechampions und französisch inspirierte Industriepolitik darf das eigentliche wirtschaftliche Powerhouse Deutschlands nicht vernachlässigt werden. Doch die Innovationsfähigkeit und der Beschäftigungsaufbau in den mittelständischen Unternehmen beruhen auf Eigenkapital. Gerade jetzt in der Krise darf überhaupt kein Zweifel aufkommen, ob der Staat etwa über eine Vermögensteuer hier ran will. Die Unternehmer müssen jetzt Vertrauen haben dürfen, dass sie aus eigener Kraft ohne zusätzliche Belastungen aus der Krise herauswachsen können.
Die Digitalisierung ermöglicht ganz neue Arbeitsformen. Wie wird sich die Unternehmenskultur durch die Digitalisierung in den Betrieben und das flexible und vernetzte Arbeiten verändern?
Wir haben in den Familienunternehmen die verschiedenen Generationen, die unterschiedlich geprägt sind – auch in Sachen Digitalisierung. Ich vertrete die Nachfolgegeneration. Eine Generation, die jung und mutig ist. Die die eine oder andere Sache ausprobiert, die dann womöglich scheitert, aber keine Angst davor hat. Auch das gehört zum Unternehmersein. Wir gehen ins Risiko und tragen die Verantwortung. Wenn ich beispielsweise meinen Vater anschaue: Er ist jetzt 60 Jahre alt, sitzt entsprechend noch im Chefsessel, aber er ist nah dran an neuen Technologien. Durch das vernetzte Arbeiten ergeben sich neue Möglichkeiten, das müssen wir alle im Blick halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wie muss man sich das in der Familie Röser vorstellen? Ist die Industrie 4.0 ein Thema beim gemeinsamen Abendessen?
Ja, warum nicht. Mein Vater ist immer schon aufgeschlossen gewesen. Unabhängig von unserem Unternehmen ist er seit 15 Jahren als Business Angel aktiv, darüber hat er viel mit neuen Technologien zu tun. Das gilt aber auch für unseren Betrieb. Ich würde sagen, dass wir als Produzent von Betonteilen Vorreiter sind. Unsere gesamte Fertigung ist automatisiert, wir sind da etwa auf dem Stand der Automobilindustrie. Unsere Produktion ist mit unserer Verwaltung digital vernetzt. Und mein Vater und ich: Wenn es in unserer Branche etwas Neues gibt, dann schauen wir uns das an. Und wenn einer von uns beiden eine neue Idee hat, dann sprechen wir darüber.
Das ist leider nicht überall so. Der Digitalisierungsstau im Mittelstand ist enorm.
Jedem Unternehmer ist heute bewusst, dass die Digitalisierung alle Bereiche betrifft. Die jungen Familienunternehmer und Gründer, wie ich, sind Digital Natives. Wir sind mit dem Internet und mit digitalen Plattformen aufgewachsen und können uns schon von daher nochmal besser hineindenken, vieles ausprobieren und haben auch keine Scheu vor neuen digitalen Lösungen. Wir sind die Generation der digitalen Transformer und haben jetzt die Aufgabe, die alt eingesessenen Familienunternehmen in die nächste Generation zu führen. Die digitale Transformation ist dabei eine enorme Herausforderung. Sie stellt viele Grundsatzfragen: Kann mein Geschäftsmodell überhaupt so weiter bestehen, wie es die letzten 100 Jahren bestand?
Was würde es für Mitarbeiter und Betriebe bedeuten, wenn mit der Digitalisierung viele Arbeiten ins Homeoffice ausgelagert würden?
Zunächst einmal funktioniert das in produzierenden Betrieben ja nur begrenzt und dann nur bei Verwaltungstätigkeiten. Nicht alle Mitarbeiter können und nicht alle Mitarbeiter wollen vom Homeoffice aus arbeiten. Andere Betriebe, in denen so gut wie alle Mitarbeiter im Homeoffice waren, berichten teilweise, dass Mitarbeiter sie bitten, zurück ins Büro zu dürfen. Weil es zu Hause zu eng ist oder ihnen der Austausch mit Kollegen in der Kaffeeküche fehlt.
Welche langfristigen Effekte erwarten Sie von dem in der Pandemie Erlernten?
Wir haben gesehen, dass wir in der Krise einen ungeheuren Digitalisierungsschub hinbekommen haben. Wir sind lockerer geworden, was Videokonferenzen und Treffen auf Online-Plattformen angeht. Wir haben uns das alles unglaublich schnell erarbeitet. Ich denke, dass wir nach der Krise in eine gute Mischform kommen. Dass es für Mitarbeiter die Möglichkeit weiterhin gibt, von zu Hause zu arbeiten, dass man aber auch regelmäßig ins Büro kommt. Es geht aber auch um Pandemie- beziehungsweise Krisenresilienz im Allgemeinen, die müssen wir uns erarbeiten und nicht den Unternehmern Eigenkapital entziehen. In der Krise haben wir erlebt, dass Eigenkapitalrücklagen die Betriebe und Mitarbeiter vor Liquiditätsengpässen oder gar Insolvenz schützen.
Nach der Pandemie rückt der Klimaschutz als eine der bedeutendsten Herausforderungen wieder in den Fokus. Auf Ihren Schultern wird der gesamte klimagerechte Umbau der Wirtschaft lasten. Haben Sie manchmal das Gefühl, die jüngere Generation werde von der älteren im Stich gelassen?
Ich finde es wichtig, dass alle Generationen an einem Strang ziehen. Ich würde da niemals die Schuldfrage stellen. Klimaschutz ist wichtig, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir unterstützen die Pariser Klimaschutzziele, wir müssen aber über den Weg dorthin diskutieren. Als mir in einer Diskussion ein Fridays-for-Future-Aktivist vorwarf, ich sei in der Betonbranche und Beton verursache viel CO2, empfahl er mir als Lösung, ich solle mein Werk schließen und mir etwas anderes suchen. Das kann doch bitte nicht die Lösung sein! Wir schaffen Infrastruktur durch ein langlebiges Produkt und zugleich Arbeitsplätze, an denen ganze Familien hängen. Wir erschaffen Wohlstand. Und wenn alle über Klimaschutz sprechen, muss im gleichen Atemzug über die Kosten gesprochen werden. Mich regt auf, wenn etwa aus dem grünen oder linken Spektrum Vorschläge kommen, wie man das Geld mit vollen Händen ausgeben kann. Und zugleich fragt sich niemand: Wie wird es eigentlich erwirtschaftet?
Wie soll denn Ihrer Meinung nach der Weg in die Klimaneutralität aussehen?
Der nationale Alleingang, also der deutsche Weg, ist teuer und er bringt dem Klima relativ wenig. Wir brauchen eine globale oder zumindest europäische Lösung. Und das beste Instrument, um den Ausstoß von CO2 zu begrenzen, ist ein globaler Emissionshandel. Damit kann man die Gesamtmenge an CO2, die jedes Jahr noch ausgestoßen werden darf, festlegen. Es ist ein marktwirtschaftliches Instrument, denn es gibt den Unternehmen Anreize, ihren CO2 Ausstoß genau dort zu drosseln, wo es am effizientesten ist.
Der Emissionshandel in allen Sektoren könnte aber auch dazu führen, dass sich Flüge und Autofahren massiv verteuern würden. Sozial ausgewogen wäre das nicht.
Über den Verkauf der Emissionszertifikate hat der Staat hohe Einnahmen. Damit muss er auch für einen sozialen Ausgleich sorgen. Allemal besser als die grüne Verbotspolitik, die einem verbietet zu fliegen oder Auto zu fahren. Die Diskussion ist teilweise weltfremd. Ich zum Beispiel komme vom Dorf, und da kommt man mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV nicht weit.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Bundestagswahl im kommenden Herbst?
Wir stehen vor einer Richtungsentscheidung: Entweder entscheiden wir uns für mehr Eigenverantwortung und einen Staat, der Chancen und das Aufstiegsversprechen ermöglicht, oder für neosozialistische, grüne Experimente mit Flugverboten, Tempolimits und höheren Steuern. Keine Frage: Wir brauchen einen Neustart in der Klimapolitik. Dazu müssen wir aber die richtigen Instrumente einsetzen. Wenn ich höre, wir müssten die Krise über höhere Steuern finanzieren oder die Schuldenbremse dauerhaft außer Kraft setzen, entgegne ich: Können wir nicht über einen weiteren Weg diskutieren, nämlich Wachstum, indem wir Unternehmen mehr Freiraum geben, den Staat entschlacken und digitalisieren und zum Beispiel beim Klimaschutz auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen?
Das neue Lieferkettengesetz wird ab 2023 auch kleinere Unternehmen verpflichten, soziale und Umweltstandards über die gesamte Lieferkette einzuhalten. Dazu kommen Klimaschutz und wachsende Risiken für die Logistik, Naturkatastrophen, Unfälle. Sind die internationalen Lieferketten in Gefahr?
Das Lieferkettengesetz ist ein gut gemeintes, aber miserabel gemachtes Gesetz, das darüber hinaus noch in einer Zeit aufgesetzt wird, in der die internationalen Lieferketten ohnehin äußerst brüchig und zunehmend instabil sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen gibt es bereits ernste Lieferengpässe bei sehr vielen strategisch wichtigen Produkten – die am Bau und der Mikroelektronik sind am offensichtlichsten. Unbestimmte Rechtsbegriffe im Gesetzestext gepaart mit weiten Klagemöglichkeiten für professionelle Kläger wie NGO und Gewerkschaften sind unkalkulierbare Risiken für unsere im Welthandel tätigen Unternehmen. Leider wird es der Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes so starken Schaden zufügen – sicherlich werden zukünftige Standortentscheidungen anders ausfallen als in der Vergangenheit.
Gestatten Sie noch die Frage: Wie stehen Sie eigentlich zur Gendersprache? Werden aus den „Jungen Unternehmern“ bald die Jungen Unternehmer:innen?
Sicherlich nicht, nein. Die Gendersprache ist genauso Symbolpolitik wie auch die Frauenquote. Ich bin Gegnerin der Frauenquote, weil ich meine, dass wir an die Wurzeln ranmüssen. Wenn wir wollen, dass mehr Frauen Karriere machen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Wenn sich top ausgebildete und bestens qualifizierte Frauen vor die Entscheidung gestellt sehen, zwischen Familie oder Beruf wählen zu müssen, dann läuft doch etwas falsch. Bei uns fehlen im Moment etwa 300.000 Kita-Plätze bei Kindern unter drei Jahren. Und in den Schulen werden Mädchen noch zu wenig neue Karrierewege aufgezeigt. Was soll eine Frauenquote, wenn es weder Kitaplätze noch entsprechend ausgebildete Frauen gibt?
A Propos: War es jemals Thema, dass Sie als Frau das Tiefbauunternehmen Ihres Vaters übernehmen werden?
Ohne Zweifel ist die Bauindustrie eine stark von Männern dominierte Branche. Aber für meinen Vater war das nie ein Thema. Meine Schwester und ich sind damit aufgewachsen. Er hat uns überall hin mitgenommen. Das Unternehmen gehörte stets zu unserem Leben dazu.
Sarna Röser, 33 Jahre alt, ist Bundesvorsitzende des Verbands „Die jungen Unternehmer“. Sie ist in vierter Generation designierte Nachfolgerin für das 1923 gegründete Familienunternehmen Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH in Mundelsheim bei Stuttgart sowie Mitgesellschafterin der Beteiligungsgesellschaft FAIR VC GmbH, die Beteiligungen an Start-Up-Unternehmen hält. Sie sitzt außerdem im Aufsichtsrat der Fielmann AG, im Beirat der Deutschen Bank, im Vorstand der Führungskräfteinitiative „Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung“ und ist stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung, die sich der Sozialen Marktwirtschaft verpflichtet sieht.
Die Jungen Unternehmer
Der Verband vertritt die Generation der Nachfolger und Gründer. Er ist Teil des Wirtschaftsverbandes „Die Familienunternehmer“, der insgesamt über 6.500 Unternehmer in Deutschland vertritt.