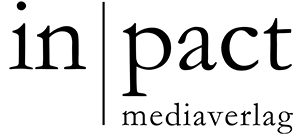Corona bringt das deutsche Gesundheitssystem an neue Grenzen: Nach den vorläufigen offiziellen Jahresergebnissen muss die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2020 ein Minus von 2,7 Mrd. Euro verbuchen. Beitragsausfälle nach einer schwächeren Beschäftigungs- und Lohnentwicklung gehen mit pandemiebedingten Mehrausgaben einher. Die Folge für die Versicherten ist, dass zum Jahreswechsel 2020/2021 insgesamt 40 Krankenkassen ihre Beiträge – teils deutlich – erhöhen.
Dabei sind die Pandemiekosten nicht das einzige Problem, das der gesetzlichen Krankenversicherung – dem ältesten Zweig des deutschen Sozialversicherungssystems – ins Haus steht. Da ist zum einen der Wettbewerbs- und Konsolidierungsdruck. Seit 1991 hat sich die Anzahl der Kassen um mehr als 90 Prozent verringert. Der Konzentrationsprozess unter den aktuell 103 Kassen wird sich voraussichtlich fortsetzen.
Und da ist die Digitalisierung, von der sich die Branche Kosteneinsparungen und Prozessfortschritte verspricht. Keine einfache Aufgabe, denn rund 73 Millionen Menschen sind an die gesetzliche Krankenversicherung angebunden. Wer hier digitalisieren will, muss große Hebel bewegen und die Sorgen und Nöte von 103 Kassen und ihren Versicherten mit Bundesrecht und den Anforderungen an digitale Prozesse in Einklang bringen.
Der lange Weg zur ePA
In einem Bereich wird das schon seit Jahren versucht: Die ePA. Seit Jahresbeginn haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine elektronische Patientenakte (ePA). Diese Akte enthält neben den Stammdaten des Versicherten Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte und Impfungen. Außerdem kann sie Daten zu Notfällen enthalten, zum Beispiel zu Allergien und Arzneimittelunverträglichkeiten, oder weitere relevante Diagnosen und Hinweise, zum Beispiel zu einer aktuellen Schwangerschaft oder zu Implantaten.
Die ePA kann also – wenn sie denn einmal ausgerollt ist – für Versicherte, Ärzte und Versicherungen viele administrative und therapeutische Schritte vereinfachen. Die breite Vernetzung zwischen Arztpraxis, Apotheke, Therapeut und Patient hat viele Vorteile: Diagnosen, Medikation, Röntgenbilder und sonstige medizinische Informationen liegen digital vor und können von den Beteiligten schneller und übersichtlicher eingesehen werden.
Am 1. Januar 2021 hat nun die erste von insgesamt drei ePA-Einführungsphasen begonnen: Die Krankenkassen bieten ihren Versicherten eine App, auf die sie per Smartphone oder Tablet zugreifen. Zeitgleich beginnt eine Test- und Einführungsphase mit ausgewählten Arztpraxen. In einer zweiten Phase in wenigen Monaten sollen alle Praxen in Deutschland mit der ePA verbunden werden, in Phase 3 zum 1. Juli müssen alle vertragsärztlich tätigen Leistungserbringer die ePA zu nutzen und befüllen wissen. Die Krankenhäuser nutzen die ePA spätestens ab dem 1. Januar 2022.
Findet dann endlich ein Projekt zu einem guten Ende, das schon seit Jahren in der Realisierung ist und große Mengen an Geld verschlungen hat? Mittlerweile droht es ja sogar zu veralten: „Wir haben eine souveräne digitale Infrastruktur, aber sie stammt aus einer Zeit, als es beispielsweise noch keine Smartphones und Cloud-Dienste gab. Einige Technik ist schon 14 Jahre alt und muss unbedingt modernisiert werden“, sagte Gematik-Geschäftsführer Dr. Markus Leyck Dieken vor wenigen Wochen in einem Interview mit dem Verband der Ersatzkassen. Die Gematik betreibt die IT-Infrastruktur im deutschen Gesundheitswesen.
Automatisierte Vorgänge
Doch über die Chancen der gesetzlichen Krankenversicherung, die Digitalisierung erfolgreich zu nutzen, entscheiden viele Faktoren. Unter anderem wie schnell die Versicherungen selber reagieren. In vielen Bereichen ist schon einiges passiert: So haben beispielsweise die meisten Betriebskrankenkassen mittlerweile Online-Geschäftsstellen etabliert, um Kundenanfragen zu beantworten. Voraussetzung dafür war, dass die Kassen ihre internen Strukturen und Geschäftsprozesse entsprechend angepasst haben.
Ein Schlüsselelement dabei ist die sogenannte Dunkelverarbeitung: Vorgänge werden automatisiert bewertet und möglichst abschließend bearbeitet. Die technischen Voraussetzungen für diesen kostensparenden Prozess sind enorm: Nur wer Formulare oder Bilddokumente richtig erkennen und beurteilen kann, wird Einsparungen für Personalkosten realisieren können und damit am Markt überlebensfähig bleiben. Der BKK Dachverband weist darauf hin, dass die Betriebskrankenkassen heute bis zu vier von fünf Versichertenvorgängen abschließend erledigen, ohne dass ein menschlicher Mitarbeiter einen Blick darauf geworfen hat.
Doch nun stellen – wie in anderen Branchen auch – neue, junge und erfolgsorientierte Start-ups das Gesundheitswesen auf den Kopf. Die Kassen sind sich der Gefahren bewusst: Schon 2018 befürchteten sie „einen eher starken bis sehr starken Einfluss durch die Digitalisierung und dadurch aufkommende Start-ups, neue Wettbewerber und digitalisierte Geschäftsmodelle“, heißt es in einer Studie des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie IMW. Vor allem die Beziehungen zu Kunden können durch die Digitalisierung massiv verändert werden. Den Drang, nun selber aktiv zu werden, verspürten sie anfangs indes nicht: Ein Drittel der Krankenversicherungen gab dem IMW zufolge an, die eigene Veränderungskultur sei „eher gering“.
Investitionen in Start-ups
Dabei hat der Gesetzgeber schon vor einiger Zeit die Weichen gestellt, um den Kassen den Anschluss an die digitale Welt der Start-ups zu ermöglichen: Dank des Digitalen Versorgungsgesetzes von 2019 können gesetzliche Krankenkassen in Start-ups investieren. Bis zu zwei Prozent ihrer Finanzreserven dürfen sie „in Anteile an Investmentvermögen“ anlegen. Rechnerisch ist das Budget viermal so hoch wie die Summe, die die Privaten Krankenversicherungen in ihren Venture-Capital-Fonds Heal Capital investiert haben. Über den mehr als 100-Millionen-Euro schweren Fonds beteiligen sich die Privaten an jungen digitalen Healthcare-Unternehmen aus Diagnostik, Therapie und Infrastruktur.
Diese Wege wollen nun auch die Krankenkassen gehen. „Krankenkassen wissen sehr gut, was in der Gesundheitsversorgung fehlt“, sagt Henrik Matthies, General Manager beim health innovation hub (HIH), jüngst in einem Interview. Der HIH-Thinktank unterstützt die Bundesregierung und andere Akteure bei neuen Digitalisierungsansätzen. Die Kassen, so Matthies, verfügten über das „tiefste Verständnis des Gesundheitswesens und seiner Regulatorik.“ Sie seien in der Lage, Versorgungslücken zu identifizieren und neue Lösungen von Start-ups in die Versorgung zu bringen. „Dieses Market-Access-Know-How fehlt allen Unternehmen, die neu ins Gesundheitswesen kommen“, so Matthies.
Um die Kassen bei der Suche nach innovativen Healthcare-Start-ups zu unterstützen, steht ihnen ein europaweites Programm zur Seite: das Venture Center of Excellence. Dahinter steckt die geballte Power der Europäischen Union in Form des European Investment Funds (EIF) – bis zu zwei Milliarden Euro sollen über den Fonds in den kommenden Jahren in aussichtsreiche Projekte im Gesundheitsbereich fließen.
Konkret bedeutet das Verfahren erst einmal, dass die Krankenkassen jeweils zunächst fünf Millionen Euro in das Venture Center of Excellence stecken – einzeln oder im Verbund. Dann erhalten sie Einblicke in konkrete Investitionen beteiligter Geldgeber und können anschließend selber in ein Start-up investieren, das zu ihrer Krankenkassenstrategie passt.
Skepsis und Kritik
Mit diesen Strategien wollen die großen Akteure im Gesundheitsbereich in Deutschland die Wege für mehr digitale Angebote und Leistungen öffnen. Doch neben diesen Akteuren gibt es weitere Parteien, die ganz entscheidend für die Digitalisierung in Deutschland sind.
Die Ärzte beispielsweise. Anders als die Apotheken tun sich viele von ihnen bislang schwer mit der Digitalisierung. In vielen Arztpraxen in Deutschland wird noch kommuniziert wie vor 20 Jahren. Wenn Ärzte sich untereinander austauschen, tun sie das meist per Brief oder Fax, so eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom und des Ärzteverbands Hartmannbund. Nur jeder 20. Arzt kommuniziert überwiegend via E-Mail mit anderen Praxen, Apotheken oder den Patienten.
Und dann natürlich die Versicherten. Ob sie die neuen Möglichkeiten als Chance begreifen oder als Bedrohung, entscheidet sich in Sachen ePA beispielsweise in Kürze. Während die Versicherungen die Akte bereitstellen müssen, sind die Patient:innen nicht verpflichtet, die Akte zu nutzen. Der Gebrauch ist freiwillig. „In den ersten zwei Jahren wären wir schon glücklich, wenn wir einen höheren einstelligen Prozentsatz der Versicherten dazu bekommen werden“, sagt Gematik-Geschäftsführer Dr. Markus Leyck Dieken. „Ab dann wird es vermutlich relativ rasch zunehmen, denn die ePA braucht das Erlebnis des Nutzens.“
In der Digitalisierung wie auch in der Corona-Pandemie gilt: Technische Möglichkeiten allein sind noch kein Garant für Erfolg. Die Menschen müssen auch bereit sein, sie zu nutzen.