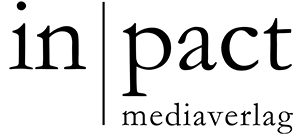Doch viele Menschen sind skeptisch und sehen den Schutz ihrer Daten gefährdet. Digitale Glaubwürdigkeit und Fairness sind deshalb unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Städte und Kommunen neue Daten erheben und auf ihrer Basis Entscheidungen treffen können.
Seit einigen Jahren erfährt der Begriff der „Smart City“ große Aufmerksamkeit: Daten stehen in Städten und Stadtforschung in bisher ungeahntem Umfang zur Verfügung. Damit verändern sich Entscheidungsprozesse durch die Digitalisierung enorm. Umso wichtiger wird der Dialog zwischen Stadtplanung und Verwaltung, Datenexpertinnen und -experten und nicht zuletzt der Zivilgesellschaft.
Diesen Dialog gestaltet das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) seit einigen Jahren intensiv mit. So ist aus einer umfangreichen Dialogplattform Smart Cities die „Smart City Charta“ entstanden. Seit Mitte 2016 haben sich die Teilnehmer:innen der Dialogplattform mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung für Städte und Kommunen beschäftigt: Vertreter:innen von Kommunen und kommunalen Verbänden, der Bundesressorts, Ministerien, der Wissenschaft und nicht zuletzt der Zivilgesellschaft.
„Mit der Smart City Charta fordert die Dialogplattform Smart Cities, die Digitalisierung nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sie aktiv im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung zu gestalten“, schreibt der ehemalige Leiter des BBSR, Harald Hermann, in seinem Vorwort. „Zwei Ziele der New Urban Agenda sind für uns besonders wichtig, nämlich zum einen lebenswerte Städte für Menschen zu schaffen und zum anderen Städte als Entwicklungsakteure anzuerkennen und zu befähigen. Denn es geht darum, wie wir in Zukunft leben wollen und die dafür nötige Handlungsfähigkeit und Gestaltungskraft der Kommunen sichern und stärken“, ergänzt Staatssekretär Gunther Adler aus dem damals dem BBSR übergeordneten Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMUB). Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wiederum hat gerade die Smart City Charta neu aufgelegt.
Verpflichtung der öffentlichen Hand
Die Nutzung anonymer Daten und Bewegungsprofile, wie sie im Konzept einer Smart City vorgesehen ist, ruft immer wieder Kritiker auf den Plan, die vor Überwachungs-Dystopien im Stile George Orwells 1984 warnen. Natürlich bergen neue Technologien auch Risiken von Fehlentwicklungen. Die BBSR-Publikation skizziert deshalb in einem „Stegreif-Szenario 2040“ Worst Cases für die Smart Cities und formuliert gleichzeitig: „Es ist darauf zu achten, dass keine neuen Machtstrukturen entstehen, die sich demokratischer Kontrolle entziehen und eine Gefahr für die Grundrechte, die Sicherheit und Privatsphäre jedes Einzelnen darstellen.“
Klar ist aber auch: Es braucht dringend Überzeugungsarbeit, damit die Smart City Charta umgesetzt werden kann, das heißt vor allem: Positivbeispiele der Umsetzung. Damit es gelingt, aus Daten zum Wohl der Gesellschaft neues Wissen zu schaffen, muss unterschieden werden, wo Digitalisierung Wissen produziert und wo bloß Daten – und dass ein Mehr an Daten nicht zwangsläufig ein Mehr an Wissen bedeutet. Big Data verändert gleichwohl, wie wir die Welt sehen, wie sich Städte in Zukunft um ihre Aufgaben kümmern und wie die Wissenschaft sich den drängenden Fragen der Stadtentwicklung nähern wird.
Dabei sollten wir aber auch darüber diskutieren, ob nicht sogar eine Verpflichtung der öffentlichen Hand besteht, aus unseren Daten einen Mehrwert zu generieren, der allen zugutekommt: etwa durch die bessere Steuerung des ÖPNV, die bewohner :innen freundlichere Gestaltung von Stadtvierteln, die bedarfsgerechte Planung von Kinderbetreuungs-Angeboten oder die Optimierung von Versorgungsnetzen. Nur ein Beispiel: Konkret gehen in Fernwärmenetzen bis zu 50 Prozent der Energie verloren, weil die Möglichkeiten prädiktiver Analysen des Verbrauchs nicht ausreichend genutzt werden. Die Kosten dieser Verluste liegen in Deutschland jährlich im achtstelligen Bereich, auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind erheblich.
Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch, neue Datenanbieter drängen aufs Spielfeld. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber es gilt zu überlegen, was das bedeutet und wie diese Daten möglichst sinnvoll integriert werden können. Datenbasiertes Entscheiden führt schließlich zu tiefgreifenden Veränderungen. Häufig werden Machtstrukturen infrage gestellt und bisherige Entscheidungsregeln entpuppen sich als Mythen. Die Beteiligten müssen darum überzeugt werden, ihre Daten zu teilen, damit mehr Wert für alle entstehen kann.
Viele Menschen betrachten solche neuen Ideen kritisch, weil sie in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz unsicher sind. Städte und Kommunen müssen genau klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sie beachten müssen und welcher Aufwand sie erwartet, um sicherzustellen, dass diese eingehalten werden. Gewisse Ideen sind mit der aktuellen Rechtslage in Deutschland nicht zu vereinbaren, weil manche Datenquellen eben qua Gesetz nicht miteinander verknüpft werden dürfen.
Digitale Glaubwürdigkeit
Der digitale Wandel hat erhebliche Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, auch und gerade, wenn Städte neue Datenquellen nutzen wollen, um Planungs-, Steuerung- und Entscheidungsprozesse zu verbessern: Welche Ampeln sollen wann auf Grün schalten, damit der Verkehr in der Stadt möglichst störungsfrei fließen kann? Wenn Bürger:innen über ein Mängelportal Straßenschäden melden, welche sollen dann mit hoher Priorität repariert werden, welche mit nachgelagerter? Wie lassen sich Lebenszyklen von Quartieren in der Planung so abbilden, dass Angebot und Nachfrage an öffentlichen Einrichtungen nachhaltig und dynamisch aufeinander abgestimmt sind?
Für amtliche Daten gibt es Gesetze und Regeln: Wer muss welche Daten zur Verfügung stellen. Im Idealfall ist sogar klar, warum wir alle diese Daten brauchen. „Digitale Glaubwürdigkeit“ ist deswegen unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Städte und Kommunen neue Daten erheben und auf ihrer Basis Entscheidungen treffen können. Ohne Glaubwürdigkeit wird es keine Bereitschaft zur digitalen Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und behördlicher Organisation geben.
Denken wir beispielsweise an ein Patent von Mastercard aus dem Jahr 2015: „Ein System, ein Verfahren und ein computerlesbares Speichermedium, das so konfiguriert ist, dass es die physische Größe der Zahlungsbegünstigten auf der Grundlage von Zahlungsvorgängen analysiert und es einem Transportanbieter erlaubt, die physische Größe der Zahlungsbegünstigten bei der Zuteilung eines Sitzplatzes zu berücksichtigen.“ Da werden aus den Einkäufen von Kundinnen und Kunden also Größe und Gewicht errechnet und an eine Fluglinie weitergegeben. Die Übergewichtige dann womöglich nicht oder nur zu wesentlich höheren Preisen mitfliegen lässt. Stellen wir uns das einmal für die Berliner U-Bahn vor – undenkbar!
Digitale Fairness
„Achtung vor informationeller Selbstbestimmung“ muss die zugrundeliegende Leitlinie sein: Es gibt kein allgemeines Recht des Staates auf die Daten der Bürger:innen. Vielleicht gibt es einen spezifischen Anspruch der Öffentlichkeit auf spezifische Daten des Individuums, ähnlich wie der Staat einen gewissen Anspruch auf das Einkommen der Bürger:innen in Form von Steuern und Gebühren erhebt. Diesen Gedanken lohnt es sich weiterzudenken, gerade wenn wir Daten als werthaltiges Gut betrachten.
Konkret könnten wir folgende fünf Überlegungen anstellen, die unter anderem auf den sieben Thesen zur „Digitalen Fairness“ des Theologen und Wirtschaftsethikers Ulrich Hemel aufbauen:
Erstens stellt sich die Frage nach dem Anspruch auf und dem Ausgleich für Daten. Auf welche Daten kann die öffentliche Hand aus berechtigtem Grund Anspruch erheben und für welche Daten muss sie eine entsprechende Gegenleistung erbringen? Zweitens geht es um die Balance zwischen Transparenz und Diskretion. Wem wird welcher Einblick in die Daten gewährt und gegebenenfalls zu welchem Preis? Drittens sollten wir über Aufbewahrungs- und Verfallsfristen nachdenken. Wie lange dürfen personenbezogene Daten gespeichert werden, und dürfen sie danach in anonymisierter Form weiter genutzt werden? Wer ist viertens zuständig für die Lösung von Konflikten? Wie können wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen, wenn es dafür noch keine allgemeinen Regeln gibt? Und fünftens geht es um die Frage der Ressourcenschonung, und zwar in einem doppelten Sinne. Führt die Digitalisierung von Prozessen per se zu Einsparungen gegenüber bisherigen analogen Verfahren? Wie wichtig ist uns der sparsame Umgang mit Daten? Sollte es generell zulässig sein, Daten zu erheben, auch wenn sie im konkreten Anwendungsfall nicht benötigt, aber später genutzt werden können?
Anspruch auf Daten
Die öffentliche Hand – Städte, Kommunen, Behörden – steht vor demselben Problem wie die Wirtschaft. Auf der einen Seite muss sie eine Vielfalt von Datenquellen zusammenführen, um aus Big Data Smart Data zu erzeugen – und dabei technische, datenschutzrechtliche und lizenzrechtliche Aufgaben bewältigen. Auf der anderen Seite steht der Wunsch nach besserer Planung und Steuerung, nach einer effizienteren Durchführung von Verwaltungsprozessen und vielleicht sogar nach neuen Datenprodukten, die man weiteren Akteuren zur Verfügung stellen kann.
Die größte Herausforderung ist keine technische. Es ist die Herausforderung, die vielen verschiedenen Akteuren dazu zu bewegen, dass sie ihre Daten teilen, um mehr Wert für alle zu schaffen und diesen Wert auch sichtbar zu machen. Den Weg zu smarten Städten können wir nur gemeinsam bewältigen, indem wir möglichst viele Menschen dazu befähigen, souverän mit den eigenen Daten umzugehen. Euphorie ist genauso fehl am Platz wie ideologische Panikmache. Stattdessen braucht es Aufklärung, Transparenz und den Mut zu innovativen Strukturen und Entscheidungsprozessen.
Digitale Glaubwürdigkeit und Fairness bedeuten eben auch, dass die öffentliche Hand das Potenzial von Daten in ihrem Verfügungsbereich nicht brach liegen lässt, sondern proaktiv zum Wohl aller Bürger:innen nutzt. Daher müssen wir das Konzept der Smart City als verpflichtenden Anspruch begreifen und nicht als Option, der sich Innovationsskeptiker:innen durch das Ausmalen von Dystopien einfach entziehen können.
Katharina Schüller
ist Vorständin der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Gründerin von STAT-UP, einem Beratungsunternehmen für Statistik und Data Science, und forscht zu den Themen Data Literacy, Datenethik und Datenkultur.